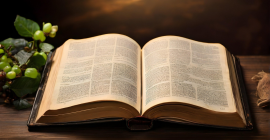Johannes 5,9b-16: “Es war aber Sabbat an diesem Tag. Da sprachen die Juden zu dem, der geheilt worden war: Heute ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, dein Bett zu tragen. Er aber antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir: Nimm dein Bett und geh hin! Sie fragten ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat: Nimm dein Bett und geh hin? Der aber geheilt worden war, wusste nicht, wer es war; denn Jesus war fortgegangen, da so viel Volk an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden; sündige nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte.”
Die Begegnung Jesu mit dem Geheilten am Teich Bethesda entfaltet sich nicht nur als Wundergeschichte, sondern als dramatischer Wendepunkt im Johannesevangelium. Was mit Heilung beginnt, endet in Verfolgung. Der Sabbat, eigentlich ein Tag der Ruhe und des Lebens, wird zum Schauplatz religiöser Konfrontation. Inmitten der Vorschriften und der aufgeladenen Atmosphäre offenbart sich Jesus als derjenige, der nicht nur heilt, sondern auch herausfordert: Er stellt die Frage nach dem Wesen der Sünde, nach der Freiheit des Geheilten und nach dem Mut zur Wahrheit. Diese Verse laden uns ein, tiefer zu blicken – auf das Spannungsfeld zwischen Gesetz und Gnade, zwischen religiöser Ordnung und göttlicher Initiative. Wer heilt, stellt infrage. Wer aufrichtet, wird angeklagt. Und wer dem Leben dient, wird verfolgt.
Es war Sabbat – der Tag der Ruhe, der heiligen Ordnung, der Unterbrechung des Alltags. Doch gerade an diesem Tag geschieht das Ungeheuerliche: Ein Mensch wird geheilt, aufgerichtet, befreit. Und statt Freude erhebt sich Anklage. Die religiöse Stimme spricht nicht vom Wunder, sondern vom Verstoß. „Es ist dir nicht erlaubt…“ – das Gesetz wird zum Maßstab, nicht das Leben. Der Geheilte trägt sein Bett, Zeichen seiner Vergangenheit, Symbol seiner Genesung – und wird dafür getadelt. Was hier aufbricht, ist ein Konflikt zwischen Regel und Gnade, zwischen starrer Ordnung und lebendiger Berührung. Der Sabbat, gedacht als Raum für Gottes Nähe, wird zum Ort der Kontrolle. Und mitten darin steht ein Mensch, der eben erst wieder gehen gelernt hat.
Der Tag der Heilung ist ein Sabbat – und damit mehr als nur ein Wochentag. Er verweist zurück auf den Anfang, auf die Ruhe Gottes nach vollendeter Schöpfung (vgl. 1. Mose 2,2). Diese ursprüngliche Ruhe war Ausdruck göttlicher Vollkommenheit, ein Raum des Friedens zwischen Schöpfer und Schöpfung. Doch durch die Sünde des Menschen wurde diese Ruhe durchbrochen (vgl. Johannes 5,17). Als Jesus nun am Sabbat heilt, berührt er nicht nur einen kranken Körper, sondern das tiefste Wesen des Sabbats selbst: Er bringt die Ruhe Gottes zurück in eine zerrissene Welt. Doch die religiösen Führer erkennen das nicht. Sie halten fest an den äußeren Verordnungen, an einem Gesetz, das sie selbst nicht erfüllen, und übersehen dabei die lebendige Gegenwart Gottes. Sie suchen Ruhe in der Tradition und übersehen den, der die wahre Ruhe bringt.
Auch heute kann der Sabbat zum Prüfstein werden – nicht als Wochentag, sondern als geistliches Prinzip. Wenn Bibeltreue zur Starrheit wird, verliert sie ihren Atem. Dann wird das Wort nicht mehr lebendig, sondern zur Schranke. Manche halten sich an Buchstaben, die sie selbst nicht tragen können, und übersehen den, der heilt. Sie ruhen nicht in der Gnade, sondern in der Ordnung. Doch Christus durchbricht diese Ordnung nicht, um sie zu zerstören, sondern um sie zu erfüllen – mit Leben, mit Freiheit, mit Wahrheit. Die starre Bibeltreue erkennt oft das Wunder nicht, weil sie nur auf das Regelwerk schaut. Doch das Evangelium ist kein Gesetzeskatalog, sondern eine Einladung zur Begegnung. Wer sich dem Wort öffnet, muss sich auch dem Geist öffnen, der es lebendig macht.
Sie erkennen nicht, wie sehr die göttlichen Verordnungen sie verurteilen – im Gegenteil: Sie sind stolz darauf. Die Gnade bleibt ihnen fremd, wie allen, die das Gesetz zur Norm für sich und andere machen. Wo das Bewusstsein der eigenen Unfähigkeit fehlt, wird das Herz hart. Statt sich über die Heilung eines Menschen zu freuen, klammern sie sich an Vorschriften. Der Sabbat, gedacht als Tag der göttlichen Ruhe und Gnade, wird von ihnen zum Joch gemacht. Sie sehen nicht das Leben, das aufbricht – sie sehen nur das Gesetz, das verletzt scheint. Doch wer den Sabbat so versteht, muss zwangsläufig mit Jesus in Konflikt geraten. Denn er bringt nicht die Last, sondern die Freiheit. Nicht die Verurteilung, sondern die Heilung. Nicht das starre Gesetz, sondern die lebendige Gnade.
Immer wenn Christus am Sabbat handelt, entblößt Er die menschlichen Deutungen und Traditionen, die diesem besonderen Tag auferlegt wurden. Er befreit den Sabbat von den Schranken, die die religiöse Praxis ihm auferlegt hat – nicht um ihn zu entwerten, sondern um uns zu befreien. Die vielen Heilungen, die gerade am Sabbat geschehen, sind kein Zufall, sondern ein tiefgreifendes Zeichen. (Matthäus 12,1–13; Markus 1,21–31; 2,23–28; 3,2–6; Lukas 4,31–37; 6,1–11; 13,10–16; 14,1–6; Johannes 5,10; 7,22.23; 9,14–16)
Diese Zeichen verkünden, dass die wahren Voraussetzungen für die Einhaltung des Sabbats, innere Ruhe, Versöhnung und Gnade, oft fehlen. Jesus tritt bewusst in die Ordnung ein, um die Gnade Gottes sichtbar und erfahrbar zu machen. Sein Handeln am Sabbat markiert einen spirituellen Einschnitt: Er stellt das Gesetz, dessen Herzstück der Sabbat geworden war, in Frage. Es ist nicht das Gesetz, das verworfen wird, sondern die Vorstellung, es könne uns das Leben schenken. Der wahre Sabbat ist keine bloße Regelbefolgung, sondern die tiefgehende Begegnung mit dem Herrn der Ruhe. In Christus wird der Sabbat nicht abgeschafft, er wird in seiner vollen Bedeutung erfüllt. Und wer dies erkennt, sieht nicht mehr nur einen Tag, sondern eine Einladung zur Heilung und Erneuerung.
Der Geheilte lässt sich nicht einschüchtern. Er beugt sich nicht dem Druck der Gesetzeslehrer, sondern hält sich an das eine Wort, das ihn aufgerichtet hat: „Nimm dein Bett und geh hin.“ Für ihn ist klar – weil der Herr es gesagt hat, ist es gut. Dieses Vertrauen ist keine Rebellion, sondern Gehorsam gegenüber der Stimme der Gnade. Es ist die einzig angemessene Antwort auf gesetzliches Denken – das eigene wie das fremde. Der Mann beruft sich nicht auf Argumente, sondern auf Begegnung. Und damit verwirft er zugleich die selbstzufriedene Beachtung des Sabbats, die sich über das Wunder erhebt. In seiner Antwort liegt ein stiller Protest gegen jene, die sich gegen ihren Messias stellen, weil sie das Gesetz höher achten als das Leben. Der Geheilte erkennt, was die Frommen übersehen: Die wahre Autorität liegt nicht im Buchstaben, sondern im lebendigen Wort.
Die Reaktion der Juden offenbart ihre Verachtung gegenüber dem Herrn. Sie nennen Ihn abwertend „der Mensch“, obwohl sie sehr wohl wussten, wer Er war – denn Seine Zeichen in Jerusalem hatten bereits gesprochen. Doch ihr Herz bleibt verschlossen. Der Geheilte hingegen hatte dem Herrn bisher nicht begegnen können – gebunden an den Ort, kraftlos, wartend. Und der Herr hatte sich ihm noch nicht offenbart, wie Er es bei der samaritischen Frau getan hatte (Johannes 4,26). Doch das ist kein Mangel, sondern ein Zeichen göttlicher Zartheit. Denn mit jedem Menschen geht Christus anders um. Er drängt sich nicht auf, sondern begegnet im Moment der Gnade. Jeder Weg ist einzigartig, jeder Ruf persönlich. Der Herr handelt nicht nach Schema, sondern nach Herz. Und wer Ihm begegnet, erkennt: Ich bin gemeint – nicht wie die anderen, sondern wie ich bin.
Christus, Sabbat und die Nachfolge heute
Die Szene am Teich Bethesda ist mehr als ein historisches Ereignis – sie ist ein Spiegel für unser heutiges Christsein. Der Geheilte steht zwischen Gnade und Gesetz, zwischen dem Wort des Herrn und der religiösen Kontrolle. Auch heute gibt es Stimmen, die das Leben aus dem Wort Gottes in enge Rahmen pressen, die Nachfolge an Regeln binden und Bibeltreue mit Gesetzestreue verwechseln. Doch wer Christus begegnet, wird nicht in ein System gezwungen, sondern in eine Beziehung gerufen. Fundamentalistisches Bibeldenken sieht oft nur den Buchstaben, nicht den Geist.
Es fragt: „Ist das erlaubt?“ – statt zu erkennen, dass der Herr selbst gesprochen hat. Der Geheilte beruft sich auf das Wort, das ihn heilte – und das ist auch für uns der Maßstab. Nicht die selbstsichere Auslegung, nicht die starre Tradition, sondern das lebendige Wort, das uns aufrichtet. Christus stellt sich dem religiösen System nicht aus Trotz, sondern weil es dem Menschen nicht mehr dient. Wer Ihm nachfolgt, wird nicht gesetzlos – aber frei. Frei, das Leben zu sehen, wo andere nur Vorschrift erkennen. Frei, den Sabbat als Tag der Gnade zu feiern. Frei, dem Herrn zu glauben, auch wenn es Anstoß erregt. Die Nachfolge Christi ist kein Gehorsam gegenüber einem Regelwerk, sondern ein Leben aus der Stimme, die sagt: „Steh auf und geh.“
Bibeltreue im Licht des lebendigen Christus
Bibeltreue – ja, unbedingt. Doch sie darf nicht zur Gesetzesreligion erstarren, die Christus ersetzt. Die Schrift ist kein juristisches Handbuch, das Paragraphen verwaltet, sondern ein lebendiges Zeugnis, das zum Herrn hinführt. Christen sind keine Gesetzesvertreter, sondern Jünger – Menschen, die dem lebendigen Wort folgen, das heilt, aufrichtet und befreit. Wer die Bibel benutzt, um zu richten, statt um zu begegnen, hat ihren Sinn verfehlt. Jesus selbst macht das deutlich, indem Er am Sabbat heilt: Er stellt das Wort nicht gegen das Gesetz, sondern ins rechte Verhältnis. Die Schrift wird nicht abgeschwächt, sondern erfüllt – durch das Leben, das aus ihr spricht. Bibeltreue bedeutet nicht, sich an Buchstaben zu klammern, sondern dem Geist zu folgen, der durch sie wirkt. Es ist Christus, der Maßstab bleibt. Und wo Er spricht, wird das Gesetz nicht entwertet, sondern durch Gnade überboten. Die wahre Treue zur Bibel zeigt sich nicht im Streit um Vorschriften, sondern im Mut zur Nachfolge – in der Bereitschaft, dem zu glauben, der sagt: „Steh auf und geh.“